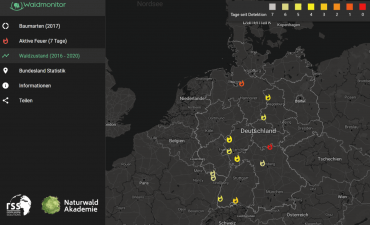Reaktion auf die Stellungnahme des Thünen-Instituts für Waldökosysteme
„Kurzfristige Klimaschutzvorteile von Waldschutz oder Waldnutzung zur Bioenergieerzeugung weiterhin unklar“ vom 07.09.2020.
Andreas Bolte und Joachim Rock verfassten als Vertreter des Thünen-Instituts für Waldökosysteme eine Stellungnahme[1.1] auf der institutionellen Website zu einem international publizierten Austausch von Positionen (Welle et al. 2020 vs. Schulze et al. 2020a). Dieser Austausch befasst sich mit der Thematik der Klimaschutzwirkung von energetischer Holznutzung im Vergleich zum Belassen von Holz im Wald. Bolte und Rock kommen zu einem vermeintlichen Urteil bezüglich der Gültigkeit der diversen Positionen. In diesem Papier weisen wir die Stellungnahme des Thünen-Instituts als sachlich unangemessen sowie irreführend zurück und kommentieren die für die Diskussion relevanten Zahlen und Berechnungen.
Hintergrund
Im Februar 2020 wurde von dem Autorenkollektiv Schulze et al. (2020a) in der Fachzeitschrift Global Change Biology Bioenergy (GCBB) ein Meinungsartikel mit dem Titel: „The climate change mitigation effect of bioenergy from sustainably managed forests in Central Europe“ („Die klimaschützende Wirkung von Bioenergie aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Mitteleuropa“) veröffentlicht. Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie, dem Erst- und Zweitautor der Veröffentlichung angehören, hat diesen Beitrag unter der Überschrift „Nachhaltige Wirtschaftswälder: ein Beitrag zum Klimaschutz. Nachhaltige Waldbewirtschaftung leistet einen größeren Beitrag zum Klimaschutz als Waldwildnis“ als Studie präsentiert[1].
Die genannte Publikation von Schulze et al. (2020a) kommt zu dem Ergebnis, dass bewirtschaftete Wälder der Atmosphäre insgesamt, also durch Zuwachsänderung und Holznutzung (v. a. energetische Substitution), 3,22 bis 3,45 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1 entziehen. Im Vergleich dazu beliefe sich der Beitrag von unbewirtschafteten Wäldern nur auf 0,37 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1. Aufgrund dieser Zahlen bewerten die Autor*innen die Klimaschutzwirkung von bewirtschafteten Wäldern als 10-mal höher im Vergleich zu ungenutzten Wäldern und folgern, dass bewirtschaftete Wälder somit für den Klimaschutz bedeutsamer seien.
Schulze et al. (2020a): „Taking the National Park of Hainich as an example, repeated inventories show an increase in stocks of 0.4 m3 ha−1 year−1 (Hainich, 2015). This would be equivalent to 0.37 t CO2 ha−1 year−1, which is about 10% of the mitigation effect of commercially managed forest. “
Der Artikel wurde seit Erscheinen u.a. von Praktikerinnen argumentativ genutzt, um sich gegen die Nichtnutzung von Wäldern zu positionieren. Das Thema ist im Rahmen von klimapolitischen Handlungsempfehlungen von großer Bedeutung und bedarf entsprechend einer umsichtigen wissenschaftlichen Diskussion, die mit der vorliegenden Reaktion auf ein angemessenes sachliches Niveau zurückgeführt werden soll.
Nachvollziehbarkeit der Werte für die Klimaschutzwirkung bewirtschafteter und unbewirtschafteter Wälder nach Schulze et al. 2020a (Tabelle 2, S. 191 und 192)
Die Klimaschutzwirkung bewirtschafteter Wälder nach Schulze et al. (2020a) ergab sich aus dem Holzzuwachs, der im Wald verbleibt, zuzüglich der Substitution fossiler Brennstoffe durch Holz. Zur Berechnung wurden Daten der dritten Bundeswaldinventur aus Deutschland verwendet. Für den Zuwachs wurden entsprechend 1,41 m3 ha-1 Jahr-1 angegeben, was bei einer Berücksichtigung von einer Holzdichte von 0,5 t m-3 und einem Kohlenstoffanteil von 50 % in der Trockensubstanz einen Wert von 1,29 t CO2 ha-1 Jahr-1 ergibt. Dieser Wert wurde mit dem Substitutionswert für Holz addiert, der laut Schulze et al. (2020a) aufgrund unterschiedlicher Annahmen im Energiemix zwischen 1,93 und 2,15 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1 variiert. Zusammen ergibt sich daraus die oben angeführte Klimaschutzwirkung bewirtschafteter Wälder von 3,22 bis 3,45 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1.
Die Klimaschutzwirkung unbewirtschafteter Wälder basierte auf dem jährlichen Zuwachswert, der mit 0,4 m3 ha-1 Jahr-1 angegeben wurde. Dieser Wert entstammt einer einzigen Literaturquelle, die sich auf Wiederholungsinventuren im Nationalpark Hainich bezieht (Schulze et al. 2020a, S. 193; Nationalparkverwaltung Hainich 2012, S. 58). Die Umrechnung[2] dieser Zuwachswerte in CO2-Äquivalente ergab 0,37 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1.
Grund für die Entgegnung von Welle et al. (2020)
Es gäbe vielerlei fachliche Kritik an Schulze et al. (2020a) zu äußern, u.a. dass etliche Befunde der internationalen Literatur nicht reflektiert wurden. Im Rahmen der von der Zeitschrift GCBB gegebenen Möglichkeiten kam als Entgegnung zunächst nur ein bzgl. der Zeichenzahl stark begrenzter ‚Letter‘ in Frage, welcher vor Abdruck intensiv geprüft wird. Im Fokus unseres Beitrags (Welle et al. 2020) stand daher das von Schulze et al. (2020a) verwendete Datenmaterial:
Der Zuwachswert von 0,4 m3 ha-1 Jahr-1 für unbewirtschaftete Wälder erschien eindeutig zu gering und entsprach nicht dem vom Nationalpark üblicherweise kommunizierten Wert. Eine genauere Betrachtung der in Schulze et al. (2020a) verwendeten Primärquelle (Nationalparkverwaltung Hainich 2012) zeigte, dass der Wert von 0,4 m3 ha-1 Jahr-1 aus der Bilanz zweier Bestandesinventuren der Gesamtwaldfläche des Hainich-Nationalparks in den Jahren 2000 und 2010 abgeleitet worden war. Hierbei lagen die mittleren Bestandesvorräte (Derbholz) im Jahr 2000 bei 363,5 m3 ha-1 und im Jahr 2010 bei 367,5 m3 ha-1. Daraus ergibt sich ein dekadischer Zuwachs von 4 m3 ha-1 und ein jährlicher Zuwachs von 0,4 m3 ha-1.
Allerdings entstammt dieser Zuwachswert aus einer unterschiedlichen Anzahl von Aufnahmeflächen, was in Schulze et al. (2020a) nicht kenntlich gemacht wurde. Im Jahr 2000 basierte die Inventur im Hainich auf 1.200 Probeflächen, während bei der Folgeinventur 2010 1.421 Probeflächen untersucht wurden. Der relativ geringe Zuwachs ergibt sich aus diesen zusätzlichen 221 neu aufgenommenen Probeflächen, die auf vorratsarmen Pionierwäldern auf Neuwaldflächen verortet sind:
„Im Nationalpark Hainich wurde bei der Inventur 2010 ein mittlerer Vorrat an lebender Derbholzmasse von 367,5 m3/ha auf der Grundlage von 1.421 Stichprobenpunkten ermittelt (Auswertung N 2010). Gegenüber der Erstaufnahme (363,5 m3/ha bei 1.200 Stichprobenpunkten) ist der Vorrat damit nur unwesentlich gestiegen. Der mittlere Vorrat 2010 wurde im Gegensatz zum Vorrat 2000 im hohen Maße durch die geringen Vorräte in den neu hinzugekommenen Pionierwäldern (vor allem im „Kindel“, siehe 3.1.2) beeinflusst, d.h. nach unten „gedrückt“. Wenn für die aktuelle Vorratsberechnung nur die 1.200 Stichprobenpunkte berücksichtigt werden, die auch in der Inventur 2000 aufgenommen wurden, ergibt sich ein mittlerer Vorrat von 453 m3/ha und damit eine mittlere Vorratszunahme seit der Erstinventur um 90 m3/ha (oder 9 m3/ha/Jahr).“ (Nationalparkverwaltung Hainich 2012, S. 58).
Bei Annahme diese Zuwachses von 9 m3 ha-1 Jahr-1 ergibt sich eine Klimaschutzwirkung von 8,25 t CO2 ha-1 Jahr-1 und damit eine etwa 2,5-mal höhere Klimaschutzwirkung von unbewirtschafteten Wäldern im Vergleich zu bewirtschafteten Wäldern[3]. Dieses Ergebnis steht im eklatanten Widerspruch zu den Ergebnissen von Schulze et al. (2020a).
Stellungnahme zu den drei Fragen von Andreas Bolte und Joachim Rock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme
Zur Frage „ob bei Schulze et al. (2020a) ein formaler Zitierfehler vorliegt, der zu „falschen“ Daten der Vorratsänderung (vgl. Vorwurf von Welle et al. 2020) führt“
Zunächst einmal muss betont werden, dass Welle et al. (2020) keine von Schulze et al. (2020a) abweichenden Rechenwege angewendet haben. Allerdings haben Welle et al. (2020) jene Daten der von Schulze et al. (2020a) verwendeten Primärquelle (Nationalparkverwaltung Hainich 2012) verwendet, die einen direkten Vergleich der beiden dort durchgeführten Inventuren zulassen und aus dem daher der tatsächliche durchschnittliche Zuwachs abgeleitet werden kann. Die Vergleichbarkeit ist nur mit denselben 1.200 Probeflächen gegeben, die in beiden Inventuren untersucht wurden. Die Einbeziehung zusätzlicher Pionierwaldflächen verfälscht das Zuwachsergebnis. Welle et al. (2020) haben daher die von Schulze et al. (2020a) durchgeführte Berechnung mit einem Zuwachswert von 9 m3 ha-1 Jahr-1 wiederholt.
Bei Schulze et al. (2020a) ist demnach nicht von einem „formalen Zitierfehler“ zu sprechen, sondern von einem entscheidenden methodischen Fehler, da sie nicht vergleichbare Zahlen als Rechengrundlage verwenden.
Zur Frage „ob die in Welle et al. (2020) alternativ präsentierten Angaben höhere Aussagekraft haben, also „richtiger“ sind“
Andreas Bolte und Joachim Rock schreiben in ihrer Stellungnahme ausführlich über die Aussagekraft, Nachvollziehbarkeit und Transparenz von wissenschaftlichen Quellen. In diesem Zusammenhang bemängeln sie die Nachvollziehbarkeit der Zahlen aus dem Inventurbericht des Hainich-Nationalpark (Nationalparkverwaltung Hainich 2012) und folgern daraus: „Daher sind die in Welle et al. (2020) verwendeten Werte für den Gesamtwaldvorrat in 2010 und die Vorratsänderung als nicht verlässlich anzusehen“. Diese Bewertung der Güte der Quelle ist bemerkenswert, da wir sie just verwenden mussten, um zu zeigen, dass Schulze et al. (2020a) unwissenschaftlich mit den darin enthaltenen Daten umgingen. Schulze et al. (2020a) verwendeten ebendiese – und nur diese – Quelle, um daraus Zahlenwerte für die Vorratsänderung in unbewirtschafteten Wäldern zu beziehen.
Das führt zu zwei Gegenfragen:
- Warum hat das Thünen-Institut für Waldökosysteme nicht die Verwendung dieser Datenquelle durch Schulze et al. (2020a) kritisiert, sondern lediglich im Zusammenhang mit der Antwort von Welle et al. (2020), die aufzeigte, dass dei Quelle nicht korrekt benutzt wurde?
- Warum äußert sich das Thünen-Institut in seiner Stellungnahme nicht zur Verlässlichkeit bzw. Richtigkeit der Zahlenwerte und Ergebnisse aus Schulze at al. (2020a)?
Es entsteht dadurch der Eindruck einer einseitigen und fachlich unzulänglichen Kritik seitens des Thünen-Instituts, wodurch sich deren Stellungnahme weniger aufklärend als Verwirrung stiftend auswirkt.
Zur Frage „ob sich die Angaben im Hainich-Inventurbericht […] als repräsentatives Beispiel für Vorräte und Vorratsänderungen in Wäldern ohne Nutzung eignen“.
Abgesehen von der Verwendung unzulässiger Zuwachsdaten basiert die Berechnung der Klimaschutzwirkung unbewirtschafteter Wälder von Schulze et al. (2020a) auf dem Zuwachswert einer einzigen Datenquelle (0,4 m3 ha-1 Jahr-1; Nationalparkverwaltung Hainich 2012), obwohl sie in Tabelle 1 einen aus anderen Quellen stammenden Wert von durchschnittlich 4 m3 ha-1 Jahr-1 zusätzlich angeben. Neben der Frage, warum nicht mehr Quellen herangezogen wurden, bleibt vor allem unersichtlich, warum Schulze et al. (2020a) nicht mit diesem Durchschnittswert rechnen, wodurch sich eine höhere Klimaschutzwirkung unbewirtschafteter Wälder im Vergleich zu bewirtschafteten Wäldern ergeben hätte[4]. Unabhängig von der inhaltlichen Qualität der Datenquelle selbst kann eine einzelne Zahlenquelle jedenfalls nicht als repräsentativ gewertet werden.
Auf die Kritik der Nichtrepräsentativität der Daten des Hainich-Nationalparks durch Kun et al. (2020) und Booth et al. (2020) haben Schulze et al. (2020a) in einer Antwort mit einer neuen Tabelle (Schulze et al. 2020b, Tabelle 1, S. 3) aus Daten der Bundeswaldinventur reagiert. Normalerweise werden in rechtfertigenden Antworten auf Kritik nicht einfach gänzlich neue Daten präsentiert. Die Antwort von Schulze et al. (2020b) auf die beiden anderen Letters, die außer Welle et al. (2020) abgedruckt wurden, ist wiederum bemerkenswert und verdient eine eingehende Würdigung, die allerdings nicht an dieser Stelle erfolgen soll. Sie war auch nicht Gegenstand unserer vor Erscheinen von Schulze et al. (2020b) eingereichten Reaktion (Welle et al. 2020). Schulze et al. (2020b) begründen die neue Tabelle damit, dass sie die nunmehr präsentierten Daten zuvor noch nicht zur Verfügung hatten, obwohl Daten aus Tabelle 2 ebenfalls aus längst verfügbaren Ergebnissen der letzten Bundeswaldinventur stammen (Schulze et al. 2020a, Tabelle 2, S.192).
Die Tabelle 1 aus der Antwort von Schulze et al. (2020b, S.3) zeigt für unbewirtschaftete Buchenwälder durchschnittliche Zuwachswerte von 8,99 m3 ha-1 Jahr-1. Vergleicht man diese Werte mit den Vorratsänderungen aus den Hainich-Inventurdaten (9 m3 ha-1 Jahr-1), entsprechen sie sich. Die Berechnung nach Schulze et al. 2020a mit diesen „neuen“ Werten würde daher zum annähernd gleichen Ergebnis führen, wie die von Welle et al. (2020) korrigierte Rechnung, dass nämlich bei Annahme des Rechenweges von Schulze et al. (2020a) unbewirtschaftete Wälder eine bis zu 2,5-mal höhere Klimaschutzwirkung erzielen als bewirtschaftete Wälder[5].
Fazit
Die Stellungnahme des Thünen-Instituts für Waldökosysteme kommt zu dem Ergebnis, dass die von Welle et al. (2020) geäußerte Kritik an Schulze et al. 2020a in wesentlichen Punkten nicht nachzuvollziehen sei, weil 1) es sich nicht um einen Zitierfehler seitens Schulze et al. (2020a) handele; 2) die Werte aus Welle et al. (2020) aufgrund der mangelhaften Transparenz des Hainich-Inventurberichts (Nationalparkverwaltung Hainich, 2012) als Grundlagenquelle nicht als „richtiger“ überzeugen könnten und 3) der Hainich-Nationalpark als nicht repräsentativ für unbewirtschaftete Wälder in Deutschland gelte.
Wir wollen diese Punkte noch einmal klarstellen:
- Wir stimmen dem Thünen-Institut für Waldökosysteme zu, dass es sich bei den von Schulze et al. (2020a) verwendeten Zuwachsdaten nicht um einen formalen Zitierfehler handelt, sondern um einen methodischen Fehler, der zu falschen Ergebnissen führt.
- Die Werte aus Table 1 (S. Anhang und Schulze al. 2020b, S.3) stammen vom Thünen-Institut für Waldökosysteme und basieren auf der Bundeswaldinventur. Sie sind daher als repräsentativ und transparent einzuschätzen. Diese Werte belegen sowohl für unbewirtschaftete Buchen- als auch Fichtenbestände in Deutschland durchschnittliche Zuwachswerte von 9 m3 ha-1 Jahr-1. Diese Werte entsprechen den Werten aus dem Hainich-Inventurbericht. Damit kann die Kritik von Welle et al. (2020) an Schulze et al. 2020a aufrechterhalten werden.
Die Kritik von Welle et al. (2020) an Schulze et al. 2020a ist in jedem Fall begründet und legitim, da die Datengrundlage der Berechnung von Schulze et al. (2020a) falsch ist und somit eine falsche Schlussfolgerung gezogen wird, die, wenn sie so zur praktischen Umsetzung kommen würde, eher einen Beitrag zum Klimawandel als zum Klimaschutz leisten würde.
Eine gemeinsame Veröffentlichung von:
Yvonne E.-M. B. Bohr, Loretta Leinen, Knut Sturm und Torsten Welle: Naturwald Akademie, Alt Lauerhof 1, D-23568 Lübeck
Jeanette S. Blumröder, Pierre L. Ibisch: Centre for Econics and Ecosystem Management, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Alfred-Moeller-Strasse 1, D-16225 Eberswalde
Tobias Wohlleben: Wohllebens Waldakademie, Nordstraße 15, D-53520 Wershofen
Sie finden alle Literaturangaben und Abbildungen in der nebenstehenden PDF zum Download.
[1] https://www.mpg.de/14452850/nachhaltige-wirtschaftswalder-ein-beitrag-zum-klimaschutz
[1.1] https://www.thuenen.de/media/institute/wo/Allgemein/StN_Schulze_Welle_Klima_von_Wald_zur_Bioenergie_2020_publ.pdf
[2] Zur besseren Nachvollziehbarkeit: 0,4*0,5*0,5*(44/12) = 0,37 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1
[3] Zur besseren Nachvollziehbarkeit: 9*0,5*0,5*(44/12) = 8,25 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1
[4] Zur besseren Nachvollziehbarkeit: 4*0,5*0,5*(44/12) = 3,67 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1 im Vergleich zu 3,22 bis 3,45 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1
[5] Zur besseren Nachvollziehbarkeit: 8,99*0,5*0,5*(44/12) = 8,24 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1 im Vergleich zu 3,22 bis 3,45 t CO2-Äq. ha-1 Jahr-1